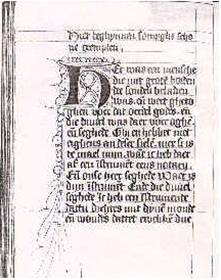|
gen zu Ungunsten
des Klosters durch die Priester von Esens und Oldendorf.
Prior
Arnold schaffte mit großem Eifer Ordnung. Ihm wurde auch großes
Verhandlungsgeschick nachgesagt, mit dem er die Rechte des Klosters
wahrte und seine Besitztümer vermehrte. So kam z.B. Margens bei Esens
als weiteres Vorwerk hinzu. Wurde seinem Handeln anfangs
auch Mistrauen entgegengebracht, erwarb er
sich durch seine aufrechte Art allmählich auch eine Freundschaft zum Häuptling
Wibet von Esens. In
seinem Kloster nahm er neben den Brüdern, die er mitgebracht hatte, vor
allem "Ausländer" aus Coesfeld, Werlsloh, Emmerich, Leerdam,
Lüttich usw. auf. Weil dies den Einheimischen missfiel, wurden zudem Laien aus der Landbevölkerung in seine Dienste
mit aufgenommen. Mit
Zustimmung des Konvents vergrößerte er die Klosteranlagen außerdem mit dem
verlassenen und verfallenen Gut Schoo. Dafür musste er zum Missfallen einiger
Konventualen andere Besitzungen,
wie in Nordorf,
abgeben.
In
Marienkamp wurde 1424 die erste Windmühle in Ostfriesland erbaut.
Mit
großem Eifer wurden nicht nur die Gebäude in Schoo instand gesetzt, es
wurden auch weitere landwirtschaftliche Gebäude in den anderen
Vorwerken errichtet. Im Kloster selbst wurden, "um der Kirche mehr
Heiligkeit zu geben", ein neuer Chor errichtet und Friedhöfe
angelegt, die durch den Suffraganbischof
der Bremer Diözese, Dietrich von Konstanz,
geweiht
wurden.
Schließlich
fügte Arnold der Rossmühle, die zum Mahlen von Öl und Getreide,
Walken von Stoffen und Waschen von Bekleidung gebraucht wurde, eine
andere Mühle außerhalb des Klosters hinzu. Dies war zu diesem
Zeitpunkt die erste Windmühle in Ostfriesland, die an dem Ort Nr. 17
der Übersichtskarte errichtet wurde. Hierbei wird es sich um eine
Bockwindmühle gehandelt haben, die es in dieser Bauweise schon im
westlichen Europa gab. Es ist zu vermuten, dass seine weit gereisten Mönche
davon Kenntnis hatten. Mit diesem Wissen und handwerklichem Geschick ist
es ihnen offenbar gelungen, diesen Mühlentyp nachzubauen und in Gang zu
setzen. Sie wurde 1670 noch an ihrem alten Standort von dem Niederländer
J. B. Regemort vorgefunden und in seine damalige Karte von unserer
Gegend eingezeichnet.
Um
1430 wollten die Benediktiner Marienkamp zurück erobern.
Der
steigende Wohlstand des Klosters wurde bedroht. Die nach Mariental bei Norden
vertriebenen Benediktiner-Mönche verbanden sich mit einigen Häuptlingen um die
neuen Bewohner von M. zu vertreiben. Zuerst wollten sie dabei Pansath überfallen.
Ein Angehöriger eines Bauern aus Utgast belauschte jedoch das Gespräch einiger
Verschworenen und informierte seinen Herrn. Dieser warnte den Klosterherren, der
zu dieser Zeit in Pansath weilte.
Darauf
suchte Arnold Schutz bei dem mächtigen Landeshäuptling Focko Ukena, der gerade die
"tom
Brocks" in der Schlacht "auf den wilden Äckern" bei Marienhafe
besiegt hatte. Es heißt, dass dieser durch seine Einflussnahme auf einige der
beteiligten Häuptlinge einen Überfall auf Marienkamp verhindern konnte.
1431
bewilligte Papst Eugen IV für das Kloster Marienkamp einen Ablass.
Im
Vatikanischen Archiv in Rom liegt eine weitere Urkunde, Repoertorium Germanicum
Pontificat Eugen IV. Bd. 1 S. 182, Nr. 1100, die belegt, dass Papst Eugen IV am
23. Mai 1431 dem Kloster M. einen Ablass bewilligte.
Darin
heißt es: Allen Gläubigen, die an bestimmten Festtagen die Kirche des
Klosters Marienkamp bei Esens im Harlingerlande, in dem über 100 Mönche nach
der Ordensregel leben, besuchen und die Bauarbeiten an der Kirche unterstützen,
und denjenigen, die dasselbe 6 Tage vor und 8 Tagen nach den Festtagen tun, wird
ein Ablass von 100 Tagen gewährt.
Daraufhin
herrschte im Kloster selbst und in den Vorwerken rege
Bautätigkeit, bei der sich ein Laienbruder mit dem Namen Friedrich,
besonders hervor tat. Durch unterschiedliche
Beschreibungen ist offen, ob es sich bei ihm um den Bruder von Prior Arnold
oder des späteren Prioren Rembert ter List handelte. Friedrich kam als Stellmacher bzw.
Zimmermann aus Frenswegen und hat in M. u.a. ein neues Dormitorium (Schlafsaal) für seine Ordensbrüder
errichtet.
Der
Esenser Chronist Hieronymus von Grest beschrieb den damaligen Zustand des
Klosters wie folgt:
Marienhof
hat in Flor gestanden.
Der Regularen Arbeit war vorwärts gegangen.
36
Geistliche und 100 Brüder wurden gepriesen,
Gäste und Arme nicht abgewiesen.
Des Klosters Gebäude groß und klein,
Einer Stadt gleich waren sie
anzusehen.
Arnold
von Creveld und 13 seiner Mönche starben 1431 an der Pest.
Das
unermüdliche Schaffen von Arnold wurde noch bevor er Pansath zu einem größeren
Kloster ausbauen konnte, durch die grassierende Seuche beendet. Er starb wie sein
Subprior Nicolaus und weitere Mönche an der Pest. Der Prior hinterließ den Ruf
eines klugen aber auch bescheidenen und mäßigen Mannes, der selbst zum Generalkapital
seines Ordens nur zu Fuß reiste.
Wenn er sich zur Essenszeit außerhalb des Klosters verspätet hatte, gab er
sich mit dem Getränk zufrieden, welches ihm die Klosterbrüder übrig gelassen
hatten.
Seine
Leiche wurde unter großer Anteilnahme, auch des Häuptlings von Esens, im Chor
der Klosterkirche begraben. Nach
ihm wurde Heinrich Bindemeister neuer Prior, der allerdings auch schon ein Jahr später
verstarb.
Das
Augustinerkloster Marienkamp entwickelte sich prächtig
weiter.
Unter
den weiteren Nachfolgern von Prior Arnold stieg Marienkamp zum
bedeutendsten Kloster der Augustiner in Ostfriesland auf.
Dies hohe Ansehen belegen zahlreiche Schenkungen wie die durch
Okko II tom Brok, der dem Kloster im April 1434 lt. Testament 14
Reinoldusgulden, 18 Goldgulden,
12 leichte Gulden und eine Tonne Bier
vermachte. 1438 schenkten Wibet sowie Ulrich von Greetsiel dem Stift ein
Stück Ettlandes im Osten von Margens und als Wibet von Esens 1440
seinem Schwiegersohn Ulrich Cirksena die Herrschaft von Esens und
Stedesdorf übergab, war der Prior des Klosters als Zeuge anwesend. Dazu
kamen nach dem OUB Bd. 1 noch etliche weitere
Schenkungen an Grundbesitz aus der Gegend von Margens. In dem neuen
Chorraum der Klosterkirche fanden zudem einige Verstorbene der Esenser Häuptlingsfamilie
ihre letzte Ruhestätte.
Auf
Verlangen des Bischofs aus Bremen wurden Marienkamp bald weitere Klöster
unterstellt. Dies waren im Jahre 1444 das Benediktinerkloster „Sylo“
aus Sielmönken im Amt Greetsiel sowie 1450 das Prämonstratenser-Nonnenkloster
„Hopsel“ in Hopels bei Friedeburg. Eine weitere Urkunde im Ostfr. UB
Bd. 1 Nr. 1081 berichtet darüber, dass die letzten drei Nonnen das
Prämonstratenser- stiftes
Coldinne bei Arle, von dem mit Marienkamp inkorporierten Kloster Sylo in
eine Gebets- gemeinschaft aufgenommen wurden. Dazu wird vermutet, dass
auch das Johanniterkloster in Burmönken von Marienkamp aus mit
verwaltet wurde. Unterdessen wurden Rembert ter List und Johannes Lap
als Prioren des Klosters genannt. Sie standen dem Konvent aber jeweils
nur eine kurze Zeit vor.
Sibet
Attena von Dornum war ein Freund des Klosters Marienkamp.
Von
1451 bis 1458 und später noch einmal ab 1473 wurde Nikolaus von Calkar
Vorsitzender im Priorat. Ihn verband eine Männerfreundschaft mit Sibet
Attena von Dornum, der inzwischen Häuptling der Herrlichkeiten Esens
und Stedesdorf geworden war. Zu den besonderen Verdiensten Sibet Attenas
in seiner Regentschaft von 1447 bis 1473 gehörte sicherlich die
Einigung des Harlinger- landes mit der Herrlichkeit Wittmund. Dies war aus
Sorge darüber geschehen, dass dieses harlingerländer Teilgebiet unter
einem andern Hoheitsanspruch fallen könnte, weil die Ehe des dortigen Häuptlings
Tanno Kankena mit Wibets zweiter Tochter Gela ohne Kinder und rechtmäßige
Erben geblieben war. Sibet hat dies Problem dadurch gelöst, dass er
im Jahre 1452 die Wittmunder Burg in einem Handstreich einnahm und Tanno
Kankena nach Dornum umsiedelte, wo er diesem einen Teil seiner eigenen
Besitzungen übergab.
Im
Jahre 1464 wurde Sibet bei der Verleihung der Grafenwürde an seinen
Onkel Ulrich, zeitgleich zum Ritter geschlagen. Ihm wurde später auch
vom Kaiser Friederich III, gestattet, „spanisch
|
gestickte Kleider“
zu tragen, als
er nach dem Tode seines Onkels Ulrich im Jahre 1566 vormundschaftlich für dessen Söhne die Geschicke Ostfrieslands bis zu
seinem Tode leitete.
Als
Sibet am 8. Nov. 1473 verstarb, ließ ihn sein ältester Sohn Hero
in einem prachtvollen Sarkophag im Chor der St. Magnus Kirche zu
Esens bestatten. Nach Sibets Testament sollten seine beiden Söhne
Hero und Ulrich, aus den Ehen mit Onna von Stedesdorf und danach
mit Margarete von Westerwolde, gleichberechtigt das Harlingerland
regieren. Da diese noch nicht volljährig und der jüngere Ulrich
beim Tode seines Vaters erst acht Jahre alt war, übernahmen dies
zunächst
|
Bild von Siebets Sarkophag in Esens in dem auch noch
weitere Familienmitglieder beigesetzt wurden.

|
Vormünder. Dabei trat besonders Hero Mauritz
Kankena in Erscheinung, der in dieser Zeit Häuptling von Friedeburg
wurde.
Prior
Nikolaus aus dem Kloster Marienkamp wurde zuvor im Jahr 1458 zum Probst
von Langen erwählt und verließ unsere Gegend. Über seine Beziehungen
zu Sibet in den Folgejahren gibt es keine Aufzeichnungen. Auffällig ist
jedoch, dass er in dessen Todesjahr 1473 nach Marienkamp zurückkehrte.
Es wurde darüber berichtet, dass der Esenser Häuptling jenem Nikolaus
sein Pferd Töpke und 20 Goldgulden, Rheinl. schenkte bzw. vermachte. Außerdem
soll dieser die Schlüssel zu einer Truhe mit Kleinodien und Geld von
Sibet zur Aufbewahrung bekommen haben.
Einige
Marienkamper Schriften wurden inzwischen wiederentdeckt.
|
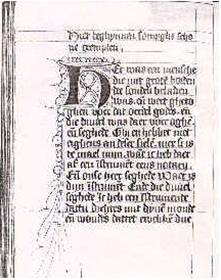
Textprobe
aus dem "Spiegel der Sünder"
|
Da
die Klosterbibliothek bei dem Brand von 1530 mit zerstört wurde,
gibt es heute nur noch Schriften und Bücher, die damals
außerhalb des Klosters waren. Dazu
gehört das von Pastor Spichal aus Esens
im Jahre 1960 wieder entdeckte, bisher älteste, handgeschriebene
Buch dieser Gegend, welches in der Handschriftensammlung der Amsterdamer
Universitätsbibliothek unter Nr. 1 G18. abgelegt ist. Dort kann die einmalige
Rarität im Handschriftensaal eingesehen werden. Johannes von
Leyerdam (Leerdam bei
Utrecht) schrieb es 1448 in Marienkamp für seinen liebsten Freund
in Christus, Alard Symonis, einen ehrsamen und weisen Mann aus
Amsterdam, unter dem Titel "Spiegel der Sünder." Diese
Schrift gelangte 1866 die in den Besitz von Prof. Moll in
Amsterdam, der sie der dortigen Universitätsbibliothek vermachte.
Die Handschrift ist 10 x 14,5 cm groß und besteht aus 160 Blättern
auf Pergament. Das Buch ist in
einem tadellosen Zustand und beschreibt
in 12 Kapiteln in niederdeutscher Sprache
eine christliche Lebenslehre. Es behandelt Beichte und Reue sowie
Himmel, Hölle, Tod und
|
Gericht an verschiedenen Beispielen. Auf Seite
85 enthält es das wohl älteste
kleine
Gemälde des Harlingerlandes. Dies zeigt, wie Gott Moses die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten überreicht.
Die Zeichnung verrät einen einfachen und schlichten Künstler.
Im
Jahre 1484 wurde ein Missale für Graf Gerd von Oldenburg angefertigt.
Als
Johannes von Bentheim im
Jahre 1484 zum Prior gewählt wurde, befand sich das Kloster auf seinem
wirtschaftlichen Höhepunkt.
Im Missale
von Kopenhagen und anderen Unterlagen sind Hinweise zu finden, dass sich der klösterlich
Landbesitz inzwischen bis in das Gronigerland und bis ins Emsland
erstreckte. In seiner kurzen Amtszeit wurde die alte Kirche durch eine
neue ersetzt, die an dem Chor aus den dreißiger Jahren dieses
Jahrhunderts angebaut wurde. Prior Johannes muss sich aber auch Gedanken darüber gemacht haben,
wie man den Fortbestand von Marienkamp für die Zukunft sichern könne.
Denn im Oldenburger Urkundenbuch
gibt es einen Eintrag: Anno
domini 1484 ego frater Johannes Bentheim, prior canonicorum regularium
monasterii prope Ezens partium Oestfrisie, hunc librum missalem feci.
Ordinavi a nostris conscribi atque finiri eodem anno predicto ac
presentari generoso et nobili militi domino Gherardo comiti
Oldenburgensi monasterii ac bonorum nostrorum gratiosissimo defensori ac
fautori, nihil inde repetendo nisi ut ipse cum nobili suorum heredum
progenie defensores nostri et fautores semper perseverent, apud
Deum et homines corpore et animore et animo perpetuo felices, incolumes
ac beati. Amen. Dieser
Eintrag besagt, dass Prior
Johannes von Bentheim dem Grafen
Gerd von Oldenburg, als Beschützer und Gönner seines Klosters, durch einen
Mönchen ein Missalbuch anfertigen und überreichen ließ. Dies Missale
wurde mit dem Bücherbestand der gräflichen Bibliothek im Vareler
Schloss im Jahre 1751 Opfer eines Brandes. Als
Prior Johannes 1488
verstarb, hinterließ er ein Kloster das nach den Worten des
Missalescheibers an Reichtümern überquoll.

Es
gab noch ein zweites Missale. Hierbei handelt
es sich um das schon mehrfach zitierte Messbuch aus Kopenhagen. Dies
seltene Exemplar aus dem 15. Jh. befindet sich in einem tadellosen
Zustand unter „Thott 149“ in der dortigen königlichen Bibliothek. Es
wurde zum Anlass der Ausstellung zur "Friesischen Freiheit" im
Jahr 2003 ausgeliehen und in der Johannes a Lasco - Bibliothek von Emden
ausgestellt. Es
ist sehr gut vorstellbar, dass es zur gleichen Zeit angefertigt und im
Kloster verwahrt wurde. Im Jahre 1492 gelangte dies Missale zum
Oldekloster. Danach wurden keine weiteren Marienkamp betreffenden
Eintragungen mehr gemacht.
In
der Beschreibung zu dem in Emden ausgestellten Exemplar hieß es, dass
diese Schrift um 1510 in den Besitz der ostfriesischen Grafen gelangt
sei. Nach dem Tode des letzten Cirksena-Sprosses, Carl-Edzard im Jahre
1744, fiel es an Friederich d. Gr. von Preußen. Da dieser zunächst die
zerrütteten Finanzen seiner neuen Provinz Ostfriesland in Ordnung bringen wollte, ließ er
u.a, die gesamte fürstliche Bibliothek versteigern. Darunter befand
sich das
Missalbuch aus dem Kloster Marienkamp.
Erworben hat es zunächst ein dänischer Graf, der es dann nach seinem Tode der königlichen
Bibliothek in Kopenhagen vermachte. Das Buch setzt sich aus 80 Bögen
Pergament zusammen, ist etwas größer als DIN A 4. Die lateinischen
Buchstaben sind groß geschrieben. Ergänzt wird der Text durch farbige
Bilder zu den hohen kirchlichen Festen. Im 18. Jahrhundert wurde das
Buch neu in Leder eingebunden und mit dem fürstlichen Wappen versehen.
Weitere Schriften bei denen es um das Kloster
Marienkamp ging
waren
die Klageschrift der Häuptlinge Hero Omken v. Esens und Ulrich
von Dornum aus dem Jahr 1503. Diese Handschrift
liegt im Staatsarchiv in Aurich (StAA Rep. 4, B13c, N4) und ist 1877 im Jahrbuch der
Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu
Emden (Emden Jb.) von Dr. Sauer beschrieben worden. Dazu
gelangen Prof. Menso Folkerts in der Groninger Universitätsbibliothek
zwei weitere Entdeckungen. Hierbei handelte es um die mathematische
Berechnung eines Kreisbogens, die 1487 von Frater Everhardus v.
Warendorp in Marienkamp erarbeitet wurde und wesentlich einfacher
gewesen sein soll, als die 1488 in Straßburg in Buchform
herausgebrachte Berechnung des Kardinals Nicolaus von Cues. Außerdem
fand er die "Groninger Handschrift Nr. 103, Blatt 232“, die auf
Walter von Euchhausen aus Marienkamp zurückgeht. Diese wurde aber im
westfriesischen Kloster Thabor bei Sneek verfasst, zu dem Marienkamp
enge Beziehungen pflegte, weil beide Klöster einmal durch Arnold von Hüls
reformiert worden waren.
|
Das
Kloster M. geriet am Ende des 15. Jahrhunderts in die Streitigkeiten zwischen
Graf Edzard von Ostfriesland und Hero Omken.
Die Fehden des Häuptlings Hero Omken aus Esens mit Graf Edzard von
Ostfriesland nahmen zu. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Kloster. So
beklagte Hero zunächst, dass sich die Geistlichen als Kundschafter des
Feindes missbrauchen ließen und diese bei ihren Streifzügen mit Lebensmittel
versorgt und im Kloster auch bekocht hätten.
Im Kloster selbst herrschte eine große Verunsicherung. Der asketische
Enthusiasmus war gewichen, ebenso die Kulturarbeit. Das Mönchtum versank
angesichts dieser unsicheren Lage in Wohlleben und Stumpfheit. Hero Omken klagte
die Mönche (es sollen vor allem Laienbrüder gewesen sein) des
leichtfertigen Umgangs mit Frauen, der Rauflust und anderer Unordnung an.
"Endlich schonten sie", wie er sagte "Gott und seine
gebenedeite Mutter nicht." Sie brächten alles bewegliche Gut beiseite
und verließen das Kloster in Scharen. Ferner beabsichtigen sie, demnächst
einen Prior aus des Grafen Land zu wählen und das Kloster in dessen Land zu
verlegen.
Hero Omken ließ 1501 die Mönche von Marienkamp einsperren.
Da die Mönche ihre Versprechen der Besserung der Zustände nicht
einhielten, wurden sie zunächst in den Klosterräumlichkeiten eingesperrt.
Hero befahl karge Kost, bis die
verschleppten Güter wieder an Ort und Stelle seien. Daraufhin haben die Mönche
nochmals Besserung versprochen. Der neu gewählte Prior, Jacobus Clivis,
verpflichtete sich in einem Vertrag (StAA Rep. 1, 440), alles Verschleppte zurückzubringen, aber
daraus wurde nichts. An dieser Urkunde befindet sich das leicht
beschädigte, spitzovale Siegel des Klosters.
Es zeigt unter einem Baldachin die Schutzpatronin Maria mit dem
Kinde. Sie wird an beiden Seiten von knienden, betenden Engeln flankiert.
Es dauerte bis 1503, ehe die Streitigkeiten beseitigt wurden. Das
Windesheimer Generalkapitel ernannte am 18. Februar zwei Kommissare, die
Prioren von Thabor und Amyngum und beauftragte sie, die Angelegenheit zu
regeln. Sie schlossen am 30. April mit Ulrich von Dornum und Meister Wichmann,
einem Pfarrer aus Esens, der für Hero Omken gekommen war, einen Vergleich.
Darin wurde das Gelöbnis des Ersatzes der weggebrachten Güter wiederholt und
dem Häuptling die Treue der Mönche versichert sowie die Absetzung des Abtes
festgesetzt. Der Abt Jacobus begab sich anschließend nach Sylmönken und wurde
dort Prior; aber die Blütezeit des hiesigen Klosters war nun endgültig vorbei.
Die
Fehde zwischen Graf Edzard I. und Hero Omken eskalierte.
Der ostfriesische Graf Edzard I. befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er konnte
es nicht verwinden, dass das kleine Harlingerland immer noch nicht zu seinem
Einflussgebiet gehörte. Mehrere Versuche hinsichtlich einer Streitschlichtung waren
gescheitert. Von Dornum aus ließ er dann um 1511 das Holtriemer Land mit dem
Dörfern Ochtersum, Barkholt, Holtgast und Utgast verwüsten und
ausplündern. Von Grest beschrieb die Situation in seiner Reimchronik
wie folgt:
Westerholt
und Nenndorp wurden spoliiert,
Dazu hatte Graf Edzard die Dornumer stupfiert.
Knechte wurden ihnen zu Hilfe gesandt,
Zu Norden hatten sie gelegen und im Brokmerland.
Vier Dörfer täten sie schänden, plündern und sticken,
Sie dachten, es würde kein Hund danach blecken.
Auch die Klöster
und Vorwerke blieben von diesen Überfällen nicht verschont:
Des
Grafen Knechte, an die Nacht gekommen,
Haben
von Marienhof mitgenommen 210 Ochsen schön –
3000
Gulden hätten sie wohlgetan –
Dazu
19 Kühe mit 50 Schafen;
18
Schweine sind auch mitgelaufen.
Wer
will die Kleinodien zählen,
Aus
dem Hause der Gäste und aus den Zellen?
Der
Schutzbrief, mit 200 Gulden erworben,
war
nass geworden und verdorben!
63
entlaufene Ochsen und Kühe
Bekamen
die Mönche wieder mit Mühe.
Die
anderen Beeste sind fortgetrieben,
Als
Besoldung sind sie den Knechten geblieben.
In
Funnix das Lager ward g´schlagen,
Was
da war, tät man verwüsten oder verjagen:
60
Kühe, vom Margenser Vorwerk genommen,
Sind
nie wieder zurecht gekommen.
Danach
das Kloster war aufgesucht,
Sie
mochten wohl was dort wurde gekocht!
Drei
Tage waren sie des Priors Gäste,
Sie
aßen und tranken auf das beste.
Beim
Abzug ging es nach ihrer Weisen,
Was
nicht niet- und nagelfest war, ließen sie reisen!
180
Beste, groß und klein,
Wurden
getrieben von Schoo allein,
Dazu
aus dem Kloster 120 Schweine,
Fürwahr,
ich begehr solche Gäste keine!
|
|
Die
Reformation führte zum Untergang vieler Klöster
Die
neue Glaubenslehre der Reformatoren Luther (1517
Thesenanschlag in Wittenberg) sowie Zwingli und Calvin (Reformation von
Zürich 1523-25) verbreitete sich sehr schnell bei den freiheitsliebenden
Friesen. Bereits um
1520 wurde davon berichtet, dass erste Predigten im lutherischen Sinne abgehalten
wurden. Ulrich von Dornum hat 1526 mit dem Oldersumer Religionsgespräch
einen Versuch unternommen, um das Nebeneinander der Katholiken und Protestanten
zu regeln. Darüber verfasste er eine Dokumentation mit der
Bezeichnung "Disputation zu Oldersum in der Grafschaft Ostfriesland
- gehalten kurz nach Viti zwischen D. Laurenz, Jacobit aus Groningen und
Magister Jürgen Aportanus, evangelischer Pastor zu Emden, in Sachen des
christlichen Glaubens".
Das
ostfriesische Grafenhaus hatte aber andere Pläne. In der s.g. Säkularisation,
die von 1525 bis 1560 betrieben wurde, zerstörten und enteigneten die Grafen Enno II. und Johann
rund 30 Klöster samt ihrer Güter, von denen keines die Reformation
überstand. Um dieses Unrecht zu
vertuschen, wurden die Klosterarchive, die z.B. Hinweise auf
klösterliche Besitzrechte enthalten konnten, komplett vernichtet (und
somit
auch umfassende geschichtliche Aufzeichnungen jener Zeit bis hin zum Mittelalter).
Belagerung
von Esens durch Graf Enno II. von Ostfriesland
Nach
dem Tode Edzards (1528) überfiel dessen Nachfolger, Graf Enno II., Wittmund und
eroberte es. Dieser Erfolg verleitete ihn, Esens ebenfalls anzugreifen. Beim Kloster
Marienkamp schlug er sein Lager auf. Im Norden der Stadt, bei Nordorf,
errichtete er außerdem ein Blockhaus, um die Zufuhr für die belagerte Stadt von Norden
her zu unterbinden. Dieses Werk war kaum zustande gebracht, als der rüstige
und tapfere Junker eines Nachts bei einem Ausfall das gräfliche Volk aus
der Schanze schlug.
Am andern Morgen ließ Balthasar er den Belagerern zum Trotz,
von der Spitze des Turmes eine eroberte Fahne wehen.
Das Ende des Klosters Marienkamp
im Jahre 1530
Als Graf Enno das Lager verlassen hatte um
weitere Verstärkung zu besorgen, gelang Balthasar ein weiterer Ausfall auf
das Kloster Marienkamp, in dem sich des Grafen Truppen verborgen hatten.
Nachdem er diese vertrieben und die Mönche nach Pansath umgesiedelt hatte, eignete er sich die verbliebenen Güter des
Klosters an und steckte es anschließend in Brand.
Spätere Funde belegen, dass bei dem Übergriff
viele Menschen (Mönche und Söldner) ums Leben kamen. Darüber schreibt
von Grest:
Des Klosters schöner Bau musst´ herunter.
Wie könnt´ solch´s nehmen Wunder?
Ein ewiges Blockhaus, den Feinden gelegen;
war für Graf Balthasar nicht zu verdrängen.
Die Mönche sind ungern fortgezogen;
Zu Pansath haben sie sich niedergeschlagen.
Als Graf Enno mit neuen Heerscharen zurückkam, versuchte
er die Festung mehrere Male vergeblich zu stürmen. Nach einer längeren Belagerung
musste Junker Balthasar von Esens sich schließlich ergeben, weil
die Vorräte ausgegangen waren.
Dieses Fenster schließen
| |