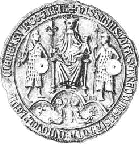|
Die Friesische Freiheit . Quelle: Hajo van Lengen (Hrsg.): Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende, Verlag Ostfriesische Landschaft, 2003, ISBN 3-932206-30-4 Unter dem Begriff "Friesische Freiheit" verbirgt sich eine Epoche im 12. bis 14. Jahrhundert. In einer Zeit als sich anderswo Adelige Herrschaftsgebiete aneigneten, in denen sie die Staatsgewalt ausübten, Zölle, Steuern und Pachten eintrieben und auch selbst die Rechtsprechung übernahmen, bildeten sich bei den Friesen kleine Bauernrepubliken, s. g. "terrae", die oftmals nur aus wenigen Ortschaften bestanden. In diesen Landgemeinden gab es genossenschaftsähnliche Gesellschaftsstrukturen mit freien Bauern, von denen sich einige Geschlechter teilweise auch schon gewisse Hoheitsrechte angeeignet hatten, und deren Bediensteten. Aus ihrer Mitte wählten sie ab 1200 so genannte "Konsuln" (Richter) und "Redjeven" (Ratsmänner) für die Dauer von einem Jahr. Es konnte aber auch festgelegt werden, in welcher Reihenfolge mehrere Männer nacheinander das Amt bekleiden sollten. Sie führten für ihre Regionen den Briefwechsel, schlossen Verträge und waren auch an einigen Markttagen in den Haupt- bzw. Vororten für die Rechtsfindung auf der Basis der Küren, Überküren und Landrechten, zuständig, die in allen friesischen Landen Gültigkeit hatten. In den kleinen Bauernrepubliken wurden größtenteils untergeordnete Landesviertel gebildet, die meistens identisch mit den Sendkirchenbezirken waren. In jedem Landesviertel wurden 4 Vertreter gewählt, die aus ihrer Mitte bestimmten, wer den Bezirk in der "Upstalsboom-Versammlung", dem höchsten Organ der "Friesischen Seelande", vertreten sollte. Bei der Wahl war das aktive bzw. passive Wahlrecht jedoch an den Grundbesitz gekoppelt. (Diese Wahlform gibt es heute noch in den Deich- und Sielachten) Hierdurch wird deutlich, dass die Bediensteten weitestgehend von der "Friesische Freiheit" ausgeschlossen waren. Auch wenn es keine Leibeigenschaft gab, bestand für sie eine große wirtschaftliche Abhängigkeit zu ihren Bauern. Diese Zentral-Versammlung der Friesen wurde nach der Versammlungsstätte Upstalsboom (ein Grabhügel aus der frühen Bronzezeit bei Rahe, westlich von Aurich) benannt. Hier trafen sich im Mittelalter (ab 1156 n. Chr.) die Abgesandten aus den einzelnen Regionen jährlich am Dienstag nach Pfingsten zu Beratungen. Die Liudvitas (Volkszeugen), Jurati (Geschworenen) und Redjeven (Ratsmänner) trafen Vereinbarungen und erließen Gesetze (Küren) sowie Verordnungen, die dann mit dem Upstalsboomsiegel (Totius Frisiae) besiegelt wurden, damit diese für alle verbindlich wurden. Es ist jedoch nicht belegt, ob diese Versammlungen tatsächlich alljährlich und immer am gleichen Ort stattfanden.
Der englischen Franziskaner Bartholomäus Anglicus beschrieb die Elemente mit denen die Friesen sich von ihren Nachbarn um 1240 unterscheiden, so: „Der Stamm ist nach außen frei, keinem anderen Herrn unterworfen. Für die Freiheit gehen sie in den Tod und wählen lieber den Tod, als dass sie sich mit dem Joch der Knechtschaft belasten ließen. Daher haben sie die militärischen Würden abgeschafft und dulden nicht, dass einige unter ihnen sich mit einem militärischen Rang hervorheben. Sie unterstehen jedoch Richtern, die sie jährlich aus der Mitte wählen, die das Staatswesen unter ihnen ordnen und regeln...“. Die Friesen leiteten das Recht zur Selbstverwaltung aus den Zeiten von Karl dem Großen ab. Aus dem Kloster Thabor bei Sneek stammt aus dem Jahre 1464 eine Überlieferung des "Westlauwer- schen Rechts", deren ältesten Rechtsätze auf das 11. Jahrhundert zurückgehen. In den dort beschriebenen sieben Magnusküren wird auf die Einnahme der römischen Burg durch die Friesen verwiesen. Ihr Anführer und Fahnenträger, Magnus, soll damals zusammen mit seinen Stammes- genossen auf alle Belohnungen des Kaisers verzichtet und stattdessen die Freiheit der Friesen in dem Gebiet von der Fli (Zuidersee) bis an die Weser gefordert haben. Dieses Recht soll ihnen sowohl vom Papst Leo wie auch vom Kaiser Karl mündlich und per Handschlag zugestanden worden sein. Dieses Recht befreite die Friesen künftig von der Heeresfolge. Es war aber auch mit der Auflage verbunden, dass sie sich künftig um den Küstenschutz gegen die Naturgewalten der Nordsee und bei der Landesverteidigung gegen die Normannen- und Wickingerüberfälle selber kümmern mussten. In der Gefahrenabwehr konnten sie sich bei der Abgeschiedenheit vieler Wohnplätze ohnehin bestenfalls auf ihre mit betroffenen Nachbarn verlassen. So eine Lebensweise unter z. T. schwierigsten Bedingen erforderte eine große Disziplin und die Achtung vor den Anderen. Es förderte aber auch den Gemeinschaftssinn in den Gemeinden. Diese gemeinsamen Leistungen verschaffte ihnen großes Selbstvertrauen mit dem sie fortan für ihre Freiheitsrechte eintraten. Die größte Gemeinschaftsleistung dieser Zeit im Küstenschutz war sicherlich der Deichbau. So konnte erreicht werden, dass der "Goldene Ring" bereits um 1200 schon weitestgehend geschlossen werden konnte. Nicht weniger erfolgreich war man auch in der Landesverteidigung, bei der eine Beistandspflicht der kleinen Länder unter einander bestand. Es wird z. B. von einigen Versuchen des Grafen von Oldenburg und anderen berichtet, die sich in dieser Zeit friesische Gebiete unterwerfen wollten. Dem widersetzte man sich jedoch mit Erfolg. Aus dieser Zeit stammt bereits der berüchtigte Schlachtruf "Lever dood, as Sklav" (Lieber Tod, als Sklave) mit dem selbst die Ritterscharen von Heinrich dem Löwen aus Braunschweig in die Flucht geschlagen wurden. Unter der Obhut der Gemeinschaft der "Sieben friesischen Seelande" (die Zahl "Sieben" steht für eine beliebige Anzahl) gelangten die Friesen zu Wohlstand und Ansehen. In einer Zeit als man sich anderswo bekriegte, war man mit den hiesigen landwirtschaftlichen Produkten ein gern gesehener Handelspartner. Einige Naturkatastrophen infolge von schweren Sturmfluten und die Volksseuche Pest stellten später neue Herausforderungen an die friesische Gemeinschaft, denen man anscheinend nicht mehr gewachsen war. So wurde die Upstalsboom-Versammlung nach 1350 zunehmend bedeutungslos. Wenn auch im Harlingerland noch bis in das Jahr 1379 über die Existenz der Konsuln berichtet wird, hatten in anderen Regionen einzelne Richter (Jurati und Redjeven) an Einfluss und Macht gewonnen. So entstand aus dem ehrbaren aber letztlich machtlosen Stand der Richter eine besondere ostfriesische Art einer Führungsschicht. Sie nannten sich Häuptlinge oder Capitales. Sie vereinigten durch wirtschaftliche Macht und Einfluss die Rechte der Richter auf ihre Person und vererbten diese auch weiter. Der Grundgedanke der Friesischen Freiheit lebte aber in der Bevölkerung weiter und wird uns auch in weiteren Kapiteln begegnen. |